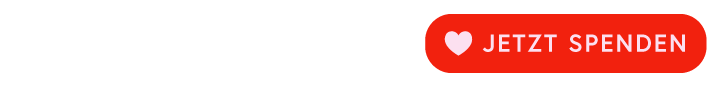Ich reise viel, um über die Arbeit von Pinkstinks zu referieren. Letzte Woche hatte ich eine ganz besonderen Termin: Ich durfte endlich Susanne Klingner kennen lernen, die die Münchner Frauenstudien leitet. Ich bin seit Jahren Fan von ihr – genauer gesagt, bin ich in ihre Stimme verliebt. Zusammen mit Katrin Rönicke und Barbara Streidl produziert sie den Lila Podcast, den wir euch schon oft ans Herz gelegt haben: Ganz undogmatisch berichten die drei aus der feministischen Szene und erzählen, wer wo was macht. Das hört sich gut beim Bahnfahren, Joggen oder Bügeln, und man ist trotz der Inhalte danach nie wütend, sondern beruhigt, dass es irgendwie alles schon wird, so lange so kühle Köpfe mit warmherzigen Stimmen darüber berichten.
Susannes Stimme fragte mich letzte Woche auf einem Podiumsgespräch ganz warmherzig, wie das denn nun so ginge als Gendermutti. Wenn einen kleine Mädchen mit Tränen in den Augen anschauen, weil man ihre geliebte Barbie gerade als pinken Sexismusmüll bezeichnet hat. Nein, so fragte sie es nicht, und wahrscheinlich ist auch der größten Pinkstinks-Kritikerin klar, dass wir Kindern nicht ihre Barbie verbieten. Aber das Bild besteht. Wie dürfen Mädchen denn noch Weiblichkeit erlernen, wenn wir auf Pink rumbashen? Wie viel Abwertung des traditionell Weiblichen ist darin?
Ich saß mit offenen Haaren, geschminkt, mit Kleid und übergeschlagenen Beinen im Podium. Wie immer. Genau diese Kritik erwartend, hole ich meine traditionell weiblichste Seite heraus, um niemanden zu verschrecken. Oder, wie Emma Watson neulich in diesem grandiosem Statement sagte: Um nicht zu „bossy“ zu wirken.
https://www.youtube.com/watch?v=Gv6Po6e7ePE
Ich könnte jetzt sagen, dass ich mich gerne schick anziehe und es genieße, wenn man mir sagt, ich sehe hübsch aus. Immerhin wird uns Sexyness heute als Empowerment verkauft. Aber ganz ehrlich: Ich fühle mich in Turnschuhen und Zopf am wohlsten. Es nervt mich, wenn Nylon-Strumpfhosen reißen, und schminken kostet die fünf Minuten extra täglich, die ich einfach nicht habe. Als 20-Jährige empfand ich meine Highheels wirklich als ermächtigend. Heute bade ich die daraus entstandenen Knieprobleme aus, wie viele andere meiner Generation.
Trotzdem würde ich meinen oder anderen Kindern nie verbieten, dem Bild zu folgen, das die Industrie ihnen als „Weiblichkeit“ verkauft. Ich würde ihnen weder die Barbie madig machen noch stöhnen, wenn sie das rosa Kleidchen haben wollen. Dies ist unser Kampf, nicht der unserer Kinder. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, wie Eltern mit ihren pinksüchtigen Kindern umgehen sollen. In meinem Buch „Pink für Alle!“ widme ich ihr deshalb, mit Bauchschmerzen, ein Kapitel. Die richtige Antwort gibt es aber nicht. In Wut-Blogeinträgen von jungen Feministinnen, die mit Pink groß geworden sind und trotzdem Gas geben, wird Pinkstinks als sexistisch bezeichnet. Bald würde man auf Schulhöfen „Pinkstinks!“ rufen und Mädchen mobben, die mit Lillifee spielen.
Neulich saß ich mit dem Head of Marketing von Lego Friends zusammen, die im letzten Jahr Milliarden gemacht haben. Danach war mir noch klarer, wie hart es wird, gegen diese Übermacht auch nur etwas zu bewirken. Die Fraktion, die Mädchen mobbt, weil sie nicht „weiblich“ genug sind, ist tausendmal stärker als jene, die Mädchen ausgrenzt, weil sie mit pinkem Spielzeug spielen. Trotzdem soll kein einziges Mädchen geärgert werden, weil sie Barbie liebt. Gerade stellte ich diese Pinkwatch ein, nachdem meine Tochter (8) das Heft im Laden in der Hand hielt und sich empört hatte: „Mami, die haben Pinkstinks echt nicht verstanden!“. Irgendwie scheine ich es zuhause also hinbekommen zu haben, Pinkstinks zu denken und zu übersetzen. Wie das als Kampagne gehen kann, ist eine tägliche Herausforderung:
Auf unseren Flyern steht „Pinkstinks“, und ein Mädchen spielt fröhlich mit einem pinken Fußball. Gerade produzieren wir eine Werbekampagne, in der viel Haut und Bettwäsche zu sehen sein wird. Wir mischen, zeigen Vielfalt, grenzen nicht aus. Das Wort „Tussi“ ist bei uns streng verboten, da werden wir radikal. Was heißt das für die Pädagogik in den eigenen vier Wänden? Natürlich kann der heiß-geliebten Barbie gleich nach der Tochter ein fetter Gute-Nacht-Kuss gegeben, und trotzdem thematisiert werden, dass die arme Barbie zusammensacken müsste, wenn sie echt wäre: Der Hals ist unnatürlich lang. Dafür kann Barbie nichts. Die Menschen, die sie gemacht haben, meinen, dass alle Frauen sehr blond, lang und extrem schlank sein sollten – und das sind doch nur ein ganz kleiner Teil der Weltbevölkerung. Das kann kaum einer erreichen, und lässt viele Frauen viel Geld ausgeben. Arme Barbie, für was die so herhalten muss! Das geht. Kleine Mädchen können mit Begeisterung ihr Prinzessinnenkleid tragen und trotzdem wütend sein, dass die Werbung für den tollen Chemiebaukasten nur an Jungs adressiert ist.
Ein kritisches Gender-Elternteil zu sein, heißt für mich nicht, den Kindern jeden Spaß zu verderben. Rosa Tütüs aufzuplustern und Tiaras zu tragen können ebenso Spaß bringen, wie im Matsch zu spielen. Es geht uns um Wahlmöglichkeiten. Um die zu erhalten bzw. zu erweitern müssen wir nach oben anstinken und nach unten, in diesem Fall zu den Kleinen hin, tief durchatmen. Demnächst macht meine Tochter übrigens ein Märchen-Theaterprojekt. Ich werde mir auf die Zunge beißen und bei der Abschlussaufführung begeistert klatschen. Bei ihrem ultracoolen Deutschlehrer habe ich mich schon versichert, dass im Winter „Märchen in ihrer feministischen Kritik“ auf dem Lehrplan stehen: Man muss ja nicht immer alles selbst machen.