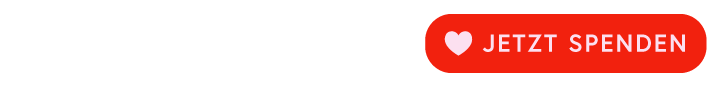Ich kenne unfassbar intelligente, wortgewandte und mutige Frauen, die mir irgendwann anvertraut haben: „Ich war magersüchtig.“ Keine von ihnen ist in dem „Goldenen Käfig“ aufgewachsen, den Hilde Bruch im ersten populären Buch über Essstörungen (1973) beschrieben hat. Sie kommen nicht aus der oberen Mittelschicht und hatten keine Mütter, die tagsüber das Haus hübsch machten, während die Väter Geld ranschafften. Ihre Eltern waren nicht überzogen leistungsorientiert.
Trotzdem haben diese Frauen jahrelang ihren Körper tyrannisiert, sich Nahrung versagt, ihren Magen durch Hungern, Fressen oder Kotzen gefoltert und schwere Spätschäden riskiert. Sie waren immer wieder in psychosomatischen Kliniken, in denen sie Mitinsassen sterben sahen. Ich kenne ihre Geschichten, weil sie alle dringend wollen, dass die Epidemie „Essstörungen“ einen Raum bekommt und sie deshalb Pinkstinks unterstützen.
Dass ich diese Frauen kenne, passt nicht ins Schema der deutschen Schulmedizin. Bis heute ist Anorexia Nervosa in der Fachliteratur vorrangig eine Krankheit, in der es um die Selbstkontrolle geht, die das Elternhaus dem Kind nicht vermitteln konnte. Das Bild dazu ist ein Klischee geworden, das ich „Mythos Magersucht“ nenne: Magersüchtige sind Kinder von leistungsorientierten, wohlhabenden Eltern, die ihren Kindern im gestressten Alltag von guten Schulnoten, Hockeyturnieren und freundlichem Lächeln nicht vermitteln konnten, einen eigenen, selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper zu entwickeln. So kontrollieren diese Kinder aus Protest ihre Nahrungsaufnahme, um der ständigen, erzwungenen Performanz etwas „Eigenes“ entgegen zu setzen.
In dieser Analyse fehlt die wichtigste Komponente: Geschlechterrolle. Genau deshalb kann die Schulmedizin dieses Konzept so schlecht auf andere Einkommens- und Herkunftsschichten übertragen. So bleibt es die Krankheit der wenigen, eigentlich priviligierten Menschen, auch im gesellschaftlichen Bild. Tatsächlich werden weniger als 1% der Menschheit klinisch magersüchtig, sagt die Statistik. Gezählt werden also nur die, die wirklich in Therapie oder Klinik gehen. Nicht jene, die sich Jahrzehnte lang auf einem Gewicht halten, der für ihren Körperbau nicht vorgegeben ist, oft durch Missbrauch von Stimulanzien wie Alkohol, Nikotin, Koffein oder Sportsucht, mit gefährlichen Auswirkungen auf Gefäße, Hormonsystem, Herz, Stoffwechsel und alle Krankheiten provozierend, die durch Stress hervorgerufen werden. Fragt man Pädagog*innen nach der Zahl der Mädchen, um die sie sich in der Hinsicht sorgen, sind das einige in jeder Schulklasse.
Selbst wenn wir bei der „klinischen“ Definition bleiben, gibt es viele Fälle, die vom klassischen Bild abweichen. Magersüchtig wird auch die Tochter bildungsferner Eltern, die Angst vor ihrer eigenen Intelligenz hat. Schlauer und stärker als die eigene Mutter? Diese gefühlte Größe DARF NICHT SEIN. Magersüchtig wird auch die Tochter streng religiöser Eltern, die ihr pubertäre Lust leben will, darin von ihrer Mutter aber immer wieder entmutigt wird: Diese Lust, diese laute Forderung ihres Körpers DARF NICHT SEIN. Magersüchtig werden auch Kinder, deren Mütter nicht auf schulische Leistung, wohl aber auf Schönheit setzen: Weil sie wissen, dass man als Frau mit Schönheit irgendwie durchkommt.
Ich rede hier von Müttern und Töchtern, weil die Schulmedizin sehr gerne von einem Mütter-Töchter-Konflikt im Bezug auf Essstörungen spricht, der eine vage Referenz zur Freudianischen Psychoanalyse aufmacht: Man muss die Mutter überwinden, um selbst zu wachsen. Das Problem beschreiben ja schon Grimms Märchen mit den omnipräsenten Stief-Müttern, die überwunden werden müssen, damit die Prinzessin heiraten kann. So ist das eben bei den Frauen, oder etwa nicht?
Worüber ich morgen in Berlin auf dem Bundeskongress Gender-Gesundheit in Anwesenheit des Gesundheitsministeriums und einiger Krankenkassen sprechen darf, ist dies: Wenn wir nicht aufhören, uns auf die autobiografische Familiengeschichte von Suchtkranken allein zu konzentrieren, werden wir Magersucht, Bulimie und Binge-Eating nie bekämpfen können. Das Problem ist nicht die Mutter, die dem Kind nicht zubilligt, groß, laut und lustvoll zu sein. Das Problem ist die Gesellschaft, die dieser Mutter beigebracht hat, ihre Tochter zurück zu halten, zu zügeln, zu beschneiden. Ob sie ihr die Genitalien zunäht oder anderweitig zur Mäßigung anhält, immer wieder ist es die Angst, das Kind sei in der Gesellschaft sonst nicht anerkannt.
Mit dem Verweis auf die eigene Biografie der Essgestörten ist die Schulmedizin fein raus. Sie muss sich mit unseren Geschlechterrollen nicht beschäftigen – weder mit rein männlichen Vorständen der Krankenkassen oder männlichen Chefarztetagen. Sie muss sich auch nicht mit machtvollen Medienformaten wie Germanys Next Topmodel oder der Modeindustrie anlegen, die auf das Kleinhalten von Frauen spezialisiert sind. Wenn Maya Götz vom IZI eine Studie rausbringt, in der ganz klar ausgewiesen wird, dass Essgestörte oft durch Germanys Next Topmodel zum Hungern kamen, heißt es in den Medien, Adipositas sei das größere Problem. Es werden Äpfel mit Birnen verglichen und so von dem reellen Problem abgelenkt – ähnlich, wie die Schulmedizin dieses Problem nicht angeht. (Germanys Next Topmodel ist nicht wirksam gegen Adipositas, so dass wir die paar Magersüchtigen als Beiprodukt in Kauf nehmen müssen. Im Gegenteil: GNTM bewirkt Selbsthass durch unrealistische Vorgaben, und kann damit Binge-Eating provozieren.) Es wäre eine politische Entscheidung, für diverse Körperbilder einzutreten und öffentlich gegen den Zwang der Modeindustrie auf Kinder und Jugendliche aufzubegehren.
Natürlich kann man nicht verlangen, dass Krankenkassen und Schulmedizin kapitalismuskritische Institutionen werden. Die AOK hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, Diversität heraus zu heben.
Am seltensten jedoch findet man nicht-normschlanke Frauen auf ihren Plakaten und Videos, sind sie beleibter, bekommt man sofort eine Einladung zum Fitnesskurs mitgeliefert oder steckt sie in den Blaumann und spricht ihnen so eine traditionell weibliche Sexyness ab. In Zeiten steigender Diabetes kann man die Vorsicht verstehen. Gleichzeitig schrieb die ZEIT neulich, dass Dicke länger leben. Die Fettphobie scheint eher gesellschaftlich denn gesundheitlich begründet.

Wichtig wäre es jedoch, auf die Gefahren eines schlanken Schönheitsideals hinzuweisen, insbesondere angesichts der über 50% Mädchen in Deutschland, die sich zu dick fühlen. Warum dann doch immer wieder – auch für Krankenkassen – mit der normschlanken Frau geworben wird, hat sicher auch mit der Zielgruppe zu tun: Auch Krankenkassen sind Mitglieder im Zentralverband der Werbewirtschaft und wissen, was sich am besten verkauft.
Unser Präventionstheaterstück „Vielfalt ist Schönheit“, womit wir Kinder in Schulen für den medialen Schönheitswahn sensibiliseren, wird von Pädagog*innen immer wieder als Angebot gefeiert, das es sonst nicht gibt – darauf sind wir stolz. Und hoffen, dass wir bald die Förderung erhalten, die es benötigt, um damit bundesweit zu touren. Eine Krankenkasse hat leider schon abgelehnt – eine Förderung von Pinkstinks wäre ein politisches Statement, das sie leider nicht tragen können. Na dann.