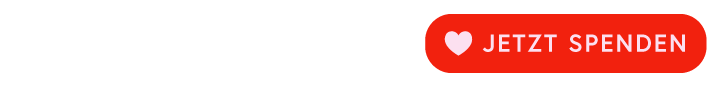Die eher konservative GEO hat gerade ihr Juli-Heft rausgebracht und überrascht uns mit einem wunderbaren Leitartikel zum Titel: Mann-Frau: Der Unterschied, der k(l)einer ist. Genau recherchiert hat Autor Fred Langer, und das Ergebnis ist ein famoser Beitrag, der fast nichts auslässt. Unsere Gehirne funktionieren verschieden, von Geburt an? Fehlanzeige. Mann und Frau sind für bestimmte Eigenschaften genetisch vorprogrammiert? Nicht nachweisbar.
Fred Langer greift das Argument auf, dass auch Natascha Walter in ihrem Bestseller Living Dolls – Der Rückkehr des Sexismus (2011) ausführt: Alle „Beweise“ der psychosozialen und motorischen Unterschiedlichkeit von Jungen und Mädchen, die angeblich schon im Säuglingsalter nachgewiesen werden konnten, basieren auf halbseidenen Studien, die oft nur an wenigen Probanden ausgeführt wurden. Warum die sich so erfolgreich verbreiteten? Weil sie unserer Erfahrung, dass Mädchen und Jungen andersartig sein sollen, eine Basis geben. Auch der Erfolg der Comedy-Shows „Caveman“ und „Cavewoman“ basieren auf diesem Wiedererkennungseffekt – dabei haben wir nicht wirklich Ahnung, wie es bei den Steinzeitmenschen aussah. Immer mehr Studien besagen, dass Männer genau wie Frauen jagten und Beeren sammelten, es also keine klare Arbeitsteilung gegeben habe.
Langers Recherche bezieht sich zum großen Teil auf das neue Buch von Cornelia Fine, Die Geschlechterlüge (2012), in der viele aktuelle Studien besprochen werden. Er konzentriert sich insbesondere auf die Gehirnforschung, die heute nachweisen kann, dass sich das Gehirn erst durch Prägung verändert und somit Zentren für Orientierungssinn oder Einfühlsamkeit stärker ausbildet. In Langers Bericht kommt mir nur ein Bereich zu kurz, der auch recht komplex ist: Die Hormone. Denn neben dem Gehirn sind es ja gerade die, die immer wieder angesprochen werden, wenn es um den geschlechtlichen Unterschied geht.
Hier ist Natascha Walters Living Dolls hilfreich, worin sie die letzten Studien zur Hormonlage der Geschlechterdifferenz begutachtet. „Zwar stehen wir, was das Verständnis der Wechselwirkung von Hormonen miteinander und mit anderen körperlichen Prozessen betrifft, nach Ansicht vieler Wissenschaftler noch ganz am Anfang, doch die Medien und einige Sachbuchautoren behaupten häufig, bestimmte Hormone zögen ganz einfach die Fäden unserer Persönlichkeit.“, sagt Walters (S. 225). Ohne alle Studien, die Walters anführt, hier wiedergeben zu können, will ich nur einige kurz zusammenfassen:
Östrogene: Walters erwähnt eine Studie, in der 140 männliche Probanden nach ihrem Spielverhalten in der Kindheit befragt wurden. Ihre Mütter hatten allesamt Östrogene während der Schwangerschaft eingenommen. Das Resultat: Ihr Spielverhalten war durchweg männlich gewesen.
Oxytocin: Neueste Studien können einen Zusammenhang von Oxytocin und Liebesfähigkeit nicht beweisen, im Gegenteil, oft steigt der Oxytocinspiegel in Streitsituationen. Die Liebesfähigkeit von Müttern, z.B., scheint nicht mit dem Oxytocinspiegel zu korrelieren.
Testosteron: Auch Langer widerlegt mit Studien, das Testosteron für logisches Denken verantwortlich ist – oft sind es die Klischees, die hier stärker auf die Probanden wirken. Werden Mädchen vor einem Mathetest daran erinnert, dass Mädchen generell in Mathematik schlechter sind, schneiden sie schlechter ab. Walters führt die Studie von Melissa Hines‘ Brain Gender (2005) an, die Frauen untersuchte, die durch die Schwangerschaft mit zuviel Testosteron versorgt wurden und unter CAH (congenitalen adrenalen Hyperplasie) litten. Es konnte nicht ermittelt werden, dass sie aggressiver oder wettbewerbsorientierter seien.
Dabei ist es nicht zu leugnen, dass Ratten bei Testosterongabe aggressiver werden. Nur bei Menschen scheint gerade diese Verbindung nicht nachweisbar, obwohl sie die Basis für das Argument „Aber Jungen sind doch nun mal Raufbolde!“ sind. Walters erwähnt unter anderem eine Studie, in denen Männern unwissentlich Testosteron, anderen wissentlich Placebos verabreicht wurde. Die ersteren fühlten sich nach einigen Wochen nicht reizbarer als sonst, die zweite Gruppe fühlte sich jedoch eindeutig impulsiver. „Wenn wir also über die vermeintlichen Folgen höherer Testosteronspiegel bei Männern reden, reden wir möglicherweise über etwas ganz anderes.“ (S.233)
Genau dieses „andere“ ist die kulturelle Prägung, die nach heutigem Stand das Spielverhalten von Jungen und Mädchen beeinflusst. Ein weiterer guter Tipp ist die Publikation des Biologen Heinz-Jürgen Voß: Geschlecht – Wider die Natürlichkeit (2011), in der noch einmal klar wird, wie wenig wir wirklich die Wirkung von Chromosomen und Hormonen auf die Geschlechtsbildung bisher erforscht haben, und dass es immer wieder zu verwirrenden Studienresultaten kommt. Dass die nicht publiziert werden, ist verständlich – einfache Wahrheiten sind zwar nicht immer wahr, verkaufen sich aber besser.
Stevie Schmiedel