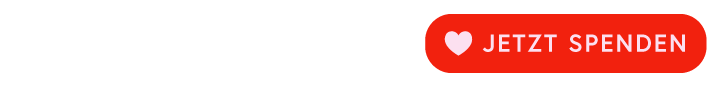ZAW steht für den Zentralverband der Werbewirtschaft. Hier sind alle Firmen, die für ihre Produkte und Dienstleistungen werben, versammelt und organisiert. Immerhin generieren Werbeeinnahmen ca. 1% des Bruttoinlandsproduktes. Um diesen Gewinn sichern oder maximieren zu können ist es sinnvoll, sich mit einheitlicher Beschlussfassung zu Entwicklungen in der Innen- oder Europapolitik zu positionieren. Und so ging es zur Jahresversammlung der ZAW 2014 um die Europawahl.
Von allen Protestorganisationen, die 2013 gegen den Werberat vorgingen, fanden wir uns allein in der Runde von Pharmazieproduzenten, Zigaretten- und Nahrungsmittelindustrie, die sich letzten Mittwoch im Bertelsmann-Haus zu Rede, Empfang und Buffet trafen. Herrn Nießner, Vorstand von Ferrero, schüttelten wir die Hand und verabredeten uns zu einem persönlichen Gespräch, um über unsere Petition gegen die rosa Überraschungseier zu sprechen. Frau Busse, Geschäftsführerin des Werberats, die als ZAW-Mitglied auch Gastgeber waren, begrüßte uns herzlich. Wir sind immer wieder beeindruckt, wie professionell der Werberat den Diskurs mit uns führt. Auch mit anderen Werberatsakteuren hatten wir gute Gespräche, in denen wir informierten, was in diesem Jahr noch von uns auf sie zukommt. Der Austausch ist stets respektvoll und interessiert.
Die Rede des Präsidenten der ZAW erwarteten wir mit Spannung: Immerhin ist unsere geplante Gesetzesnorm gegen geschlechtsdiskriminierende Werbung wiederholt kritisiert worden, gegen das Europarecht zu verstoßen. Dabei wird die Öffnungsklausel in Richtlinie 2005/29/EG-(7) verschwiegen, die den Mitgliedsstaaten erlaubt, „weiterhin Geschäftspraktiken aus Gründen der guten Sitten und des Anstands verbieten zu können“. Auf geschlechtsdiskriminierende Werbung ging die Rede zu unserer Enttäuschung jedoch nicht ein. Auch der relevante Auszug im Jahresbuch der ZAW, das an diesem Tag erschien, sprach nicht davon. Keiner der Punkte, die die ZAW als deutsche Probleme mit den europäischen Richtlinien aufführte, befasst sich mit Sexismus. Aber ganz vorn in der Problemliste stand die „überhöhte“ und „emotional geführte“ Diskussion um Kinder. Warum denn nun bitte in Europa diskutiert würde, dass Kinder bis zum 12. Lebensjahr als Konsument*innen nicht mehr angesprochen werden sollten? Dabei gäbe es überhaupt keine wissenschaftlichen Beweise, dass Kinder durch Werbung negativ beeinflusst werden würden!, donnerte der ZAW-Präsident, Andreas Schubert. Adipositas wären ja nun eindeutig nicht das Resultat von Werbung, sondern mangelnden verantwortlichen Verhaltens der Eltern!
Passend dazu folgte seiner Rede ein Appell des britischen Botschafters, Simon McDonald, die europäische Legislative so zu gestalten, dass in die Entwicklung europäischer Richtlinien stärker eingegriffen werden könne: Zur Not mit einer roten Karte. Dazu starker Applaus.
Im Jahrbuch der ZAW, das wir gleich studieren durften, betonte der Abschnitt über den Werberat das Balancegebot, dass ihm als selbstregulierendes Gremium der Werbewirtschaft auf erläge: Kinder seien nur eine Interessensgemeinschaft von vielen, und es müssten bei der Bewertung von Werbung alle in den Blick genommen werden. Dass wir dies wiederholt lesen und hören, macht es nicht besser. Kinder sollten die Gemeinschaft sein, die vorranging in ihrer Gefährdung berücksichtigt wird. Denn, lieber Herr Schubert, dass Werbung Kinder beeinflusst, dafür brauchen wir keine Studien. Dafür gibt es Zahlen.
2,7 Milliarden Euro konnten Kinder 2013 ausgeben. Ihre Eltern zahlten für ihre Kleidung, Kosmetik, Nahrung, Spielsachen und Naschzeug sicher noch einiges mehr. Da ein Großteil der Werbung für Kinderprodukte in Kinderfernsehen oder Internet geschaltet wird, kommen die Eltern selten selbst auf die Idee, dass ihr Kind dieses oder jenes Produkt unbedingt haben muss. Deshalb gibt es auch das Wort „Pester-Faktor“. Diese Vokabel der Werbewirtschaft scheint an Herrn Schubert vorbei gegangen zu sein. Es bezeichnet die Häufigkeit, mit der ein Kind „Bitte!“ jammern muss, bis die Eltern überfordert einlenken. Die Sozialarbeiter*innen, Eltern und Pädagog*innen unter uns kennen diesen P-Faktor, dadurch verunsicherte Eltern und jene, die schon aus Überarbeitung oder Nichtwissen nachgeben, sehr gut. Wir kennen auch die Zugzwänge, den Druck der Peer-Groups, der daraus entsteht. Wir kennen das „Ich will jetzt nur noch rosa Ü-Eier!“ und das „Und eine Barbie Fashionista dazu!“. Wir kennen die Wut, wenn unsere Kinder davon eingelullt werden und wir ständig „nein“ sagen müssen, und die Angst, das Kind in seiner Peer-Group auszuschließen, weil die anderen Eltern schon „ja“ gesagt haben.
Aber wir leben ja auch in einer ziemlich anderen Welt. Und die scheint der ZAW, nach wie vor, ziemlich fern.
PS: Nach unserem Erlebnis bei der ZAW sprachen wir mit Anne Markwardt von Foodwatch. Sie erläuterte:
„Die britische Lebensmittelsicherheitsbehörde hat schon 2003 festgestellt, was die WHO dann 2009 in einem Meta-Review noch mal bestätigt hat: dass Werbung die Ernährungsgewohnheiten und Präferenzen von Kindern sehr wohl beeinflusst und die vorhandene Datenlage den Effekt sogar wahrscheinlich noch unterschätzt, weil sich die meisten Studien auf Fernsehwerbung beziehen ( http://www.who.int/dietphysicalactivity/Evidence_Update_2009.pdf S.182 + . http://multimedia.food.gov.uk/multimedia/pdfs/foodpromotiontochildren1.pdf) Auf Basis dieser Erkenntnisse hat Großbritannien immerhin die Lebensmittelwerbung im Kinderfernsehen reguliert, während die WHO daraus eine klare Forderung nach der Beschränkung von an Kinder gerichtetem Lebensmittelmarketing ableitet, um den Ernährungs- und Gesundheitsstatus von Kindern zu verbessern. Ein ein-eindeutiger Zusammenhang zwischen Adipositas und Werbung wird allerdings wahrscheinlich nicht gefunden, nicht nur weil Wissenschaft ja nie ein-eindeutig ist, sondern weil das schon methodisch sehr schwierig ist. Epidemiologische Studien, die Menschen nach ihren Essgewohnheiten oder ihrem Fernsehkonsum befragen sind häufig ungenau, weil sie sich auf Selbstauskünfte verlassen müssen. Gerade den Konsum von Süßigkeiten, Snacks und auch Medienkonsum wie Fernsehen unterschätzen Befragte ja oft – absichtlich oder unabsichtlich (sozial unerwünschtes Verhalten usw.). Außerdem gibt es keine Kontrollgruppe. Weder die Werbung noch das Angebot von Kinderlebensmitteln kann in der realen Lebenswelt schließlich ausgeblendet werden. Experimentelle Studien, bei denen etwa Kindern Werbung gezeigt und ein Snack angeboten wird, um zu testen, ob die Werbung ihren Appetit verändert oder inwiefern ein beliebter Sportler auf der Verpackung ihre Auswahl für ein ungesundes Produkt beeinflusst, können dann zwar Verhaltensänderungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe messen, aber nicht langfristig verfolgen, wie sich das Gewicht der Kinder in ihrem normalen sozialen Umfeld entwickelt. Die wissenschaftlichen Studien haben also ihre Grenzen.“
Und weiter: „Im Fall des an Kinder gerichteten Junkfoodmarketings muss das Vorsorgeprinzip angewendet werden, das in der europäischen Verfassung verankert ist. Es gilt für die Bereiche Umweltschutz, Agrarpolitik und menschliche Gesundheit und dient dazu, Risiken für langfristige schädliche Auswirkungen auf Umwelt und die Gesundheit von Menschen vorsorglich zu vermeiden, auch wenn sie noch nicht mit letzter wissenschaftlicher Sicherheit nachgewiesen sind. Entscheidend ist, dass es ausreichend Hinweise gibt, dass befürchtet wird, ein Schaden könnte eintreten und dass die Mittel angemessen sind. Weniger Werbung und Junkfood können der Gesundheit von Kindern definitiv nicht schaden und beschränkt werden sollte nach Vorstellung der meisten Befürworter dieser Maßnahme zunächst ja auch erst einmal nur das Marketing für unausgewogene Produkte. Die Unternehmen könne also weiter Werbung treiben und selbstverständlich auch ihre Produkte anbieten – aber sie sollen Kindern bessere Produkte verkaufen und endlich Verantwortung übernehmen. Die Adipositasgesellschaften, die Herzgesellschaften, Kinderärzte, die Diabetes-Verbände, die WHO und sogar die UN fordern die Beschränkung des an Kinder gerichteten Lebensmittelmarketings – dass die Wirtschaft trotzdem weiterhin jede Verantwortung abstreitet zeigt, dass sie von alleine nichts ändern wird. Deshalb brauchen wir eine gesetzliche Regulierung.“